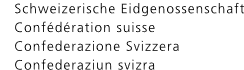«Die Stärke der schweizerischen Sicherheitspolitik liegt im Verbund»
Staatssekretär Markus Mäder arbeitet an der Sicherheitspolitischen Strategie 2025 – und ist überzeugt davon, dass für die Verteidigung der Schweiz nicht nur die Stärkung der militärischen, sondern auch der zivilen Abwehr nötig ist.
27.12.2024 | Interview: stratos, Christoph Brunner
Herr Mäder, wie sicher ist der neutrale, bewaffnete Kleinstaat Schweiz inmitten Europas heute?
Markus Mäder: Ein direkter bewaffneter Angriff auf die Schweiz ist nach wie vor unwahrscheinlich. Wir sind umgeben von Ländern, welche unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Werte teilen. Zudem profitieren wir von der Stabilität, welche die NATO und die Europäische Union gewährleisten. Die Schweiz befindet sich also in einer geografisch und geopolitisch nach wie vor vorteilhaften Lage. Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen, dass sich die Sicherheitslage in unserem strategischen Umfeld massiv verschlechtert hat und wir eine weitere Eskalation nicht ausschliessen können. Der russische Angriffskrieg hat die gesamte europäische Friedens- und Sicherheitsordnung erschüttert, mit weitreichenden sicherheitspolitischen Auswirkungen auf den gesamten Kontinent und darüber hinaus. Es handelt sich um eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und der UNO-Charta, wie auch der Prinzipien der europäischen Sicherheitsarchitektur, was die regelbasierte internationale Ordnung sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene schwächt – und anderen gewaltbereiten Nachahmern Vorschub leisten kann.
Der russische Angriffskrieg ist nicht die einzige Bedrohung …
Richtig, der Krieg geht einher mit hybrider Konfliktführung in Europa, in Form von Beeinflussung und Desinformation, Spionage, Cyberangriffen und Sabotageaktionen. Der Krieg im Informations- und Cyberraum ist auch in der Schweiz eine Realität. Als offene, liberale, hochgradig vernetzte Gesellschaft und als technologieabhängiger Wirtschaftsstandort dürfen wir unsere Verwundbarkeit nicht unterschätzen. Die Sicherheit und Integrität von Information ist längst ein kritischer Faktor für das Funktionieren von Staat und Wirtschaft. Nicht zu vergessen ist zudem die nach wie vor bestehende Bedrohung durch islamistisch motivierten Terrorismus und gewalttätigen Extremismus.
Sie haben es erwähnt: Wenige Flugstunden von Genf, Bern, Zürich und Lugano entfernt wird seit Februar 2022 ein brutaler Krieg ausgetragen, mit einem unfassbaren Mass an Zerstörung, mit unermesslich grossem Leid und Elend für die ukrainische Zivilbevölkerung, mit zehntausenden gefallenen Soldaten auf beiden Seiten. Welche Folgen hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konkret für die Sicherheitspolitik der Schweiz?
Es handelt sich um eine sicherheitspolitische Zäsur, welche die europäische Sicherheit und damit auch die Sicherheitspolitik der Schweiz noch auf Jahre und Jahrzehnte hinaus prägen wird. Mit der russischen Aggression ist der Krieg auf dem europäischen Kontinent in einer Dimension zurück, wie wir ihn seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 nicht mehr gekannt haben. Viele in Westeuropa haben geglaubt, dass Krieg als Mittel zur Durchsetzung von machtpolitischen Interessen in unserem Umfeld definitiv der Vergangenheit angehöre und aufgrund der wachsenden Interdependenzen nicht mehr möglich sei. Eine der zentralen Folgen dieser Zäsur ist, dass wir uns grundsätzlich, ernsthaft und systematisch mit dem Phänomen Krieg als reale Entwicklungsmöglichkeit beschäftigen müssen, und zwar über die Armee hinaus. Unser sicherheitspolitisches Denken und Handeln muss sich mit diesen Bedrohungen und Gefahren auf internationaler Ebene befassen, aber auch mit allfälligen Chancen.
Der Fokus muss auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und die Intensivierung der internationalen Kooperation gelegt werden. Diese zwei Handlungsfelder bedingen und begünstigen sich gegenseitig.'
Und was bedeutet das konkret für die Armee?
Der Fokus muss auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und die Intensivierung der internationalen Kooperation gelegt werden. Diese zwei Handlungsfelder bedingen und begünstigen sich gegenseitig. Wenn wir als verteidigungsbereit und kooperationsfähig wahrgenommen werden, erzielen wir die grösste Abhaltewirkung gegen Akteure, die unsere nationale Sicherheit bedrohen könnten – ganz nach dem zeitlosen Motto der Kriegsverhinderung: «Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor». Darüber hinaus müssen wir uns überlegen, wie wir der hybriden Konfliktführung erfolgreich begegnen können. Es geht also letztlich um die ganzheitliche Stärkung unseres sicherheitspolitischen Instrumentariums, sowohl der militärischen wie auch der zivilen Abwehrfähigkeiten.
Muss die Schweiz also zurück zum Konzept einer Gesamtverteidigung wie im Kalten Krieg?
Der Begriff der «Gesamtverteidigung» steht für das Abwehrkonzept während des Kalten Krieges und ist deshalb historisch besetzt. Die Rahmenbedingungen sind nicht mehr dieselben wie damals – einen Cyberraum beispielsweise gab es damals nicht, und auch die grenzüberschreitende Vernetzung unserer kritischen Infrastrukturen war noch weniger ausgeprägt. Ich plädiere deshalb dafür, dass wir unsere Überlegungen nicht an diesem Begriff festmachen, sondern uns eine gewisse begriffliche und damit gedankliche Freiheit bewahren. Aktuell bleibt jedoch der Kerngedanke der damaligen Gesamtverteidigung, sämtliche Mittel unseres Staates und unserer Gesellschaft zugunsten der umfassenden Verteidigung der Schweiz aufeinander abzustimmen. Diesen Ansatz sollten wir übernehmen, müssen ihn aber weiterentwickeln und den aktuellen Gegebenheiten anpassen.
Welches sind neben dem Ukrainekrieg und seinen Auswirkungen die inhaltlichen Schwerpunkte Ihrer Arbeit, seitdem Sie am 1. Januar 2024 Ihre Tätigkeit als Staatssekretär für Sicherheitspolitik im VBS aufgenommen haben?
Grundsätzlich ist es so, dass die Sicherheitspolitik in der ganzen Breite und Tiefe Hochkonjunktur hat. Es stellen sich zahlreiche fundamentale Fragen, weshalb wir als SEPOS derzeit von einem Tagesgeschäft getrieben sind, das sich wie ein Marathonlauf mit hohem Tempo anfühlt. Ein zentrales Geschäft auf der konzeptionellen Ebene ist die Erarbeitung der Sicherheitspolitischen Strategie der Schweiz 2025, bei der das SEPOS die Federführung innehat und alle relevanten Partner miteinbezieht – die sieben eidgenössischen Departemente, die Bundeskanzlei, die Kantone sowie weitere sicherheitspolitische Akteure. Diese Strategie wird sicherheitspolitische Interessen, Ziele sowie Mittel und Wege zu deren Erreichung aufzeigen.
Ein Schlüsselprojekt also. Können Sie schon etwas zur inhaltlichen Stossrichtung sagen?
Ich möchte der laufenden Strategieschöpfung nicht vorgreifen. Aber wesentliche inhaltliche Stossrichtungen, die in der Sicherheitspolitischen Strategie 2025 in noch zu bestimmender Form adressiert werden sollen, sind die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, die Stärkung der zivilen Abwehrfähigkeiten, das bessere Zusammenwirken sämtlicher Mittel, die Intensivierung der internationalen Kooperation, Überlegungen zu erhöhter nationaler Resilienz, der Umgang mit Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten oder auch die Auswirkungen der technologischen Entwicklungen auf die Sicherheitspolitik. Zu all diesen Themen werden wir eine strategische Einschätzung und erste Lösungsansätze liefern müssen.
Welches sind weitere inhaltliche Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Dazu gehört beispielsweise der systematische Umgang mit Desinformations- und Beeinflussungsaktivitäten, welche sich gegen die Schweiz richten. Diese haben in den vergangenen zwei Jahren zugenommen, und wir müssen uns überlegen, wie wir derartigen Kampagnen begegnen und ihre schadenbringenden Effekte abwenden können. Ein weiteres Thema ist die Früherkennung von sicherheitspolitischen Bedrohungen und Chancen und, wie wir dazu greifbare Handlungsoptionen zuhanden der politischen Ebene formulieren können. Schliesslich machen wir uns auch Überlegungen, wie die Schweiz trotz schwieriger internationaler Lage relevante Beiträge zu internationalen Friedensmissionen leisten kann. Hinzu kommt die Informationssicherheit, die gewissermassen überhaupt erst die Voraussetzung schafft für das sicherheitspolitische Handeln. Und nicht zu vergessen: Was mich in den vergangenen Monaten, der Startphase des SEPOS, ebenfalls sehr beschäftigt hat, war der Aufbau eines neuen und weitgehend eigenständigen Bundesamtes mit rund 100 Mitarbeitenden – wofür wir Betrieb, Organisation, Personal, Führung, Kommunikation, Recht und alle weiteren dafür erforderlichen Querschnittsbereiche etablieren mussten.
Das SEPOS ist ein neuer Akteur im bestehenden, eingespielten Gefüge der Sicherheitspolitik der Schweiz. Welche Funktion und welche Rolle wird es darin einnehmen können?
Das SEPOS hat den Anspruch, ein Kompetenzzentrum für Sicherheitspolitik des Bundes zu sein. In Zusammenarbeit mit weiteren Verwaltungseinheiten hat es dafür zu sorgen, dass der Bund über übergeordnete konzeptionelle Grundlagen für eine kohärente Sicherheitspolitik verfügt sowie eine gesamtheitliche und vorausschauende Sicherheitspolitik auf strategischer Ebene führen kann. Und das ist nur auf der Grundlage der Informationssicherheit möglich, für die das SEPOS ebenfalls zuständig ist. Entsprechend haben wir uns in der bestehenden Landschaft zu verwurzeln, zu vernetzen und auch zu positionieren – und dies umfassend, das heisst intradepartemental, interdepartemental, im nationalen Verbund, aber auch vis-à-vis unseren internationalen Partnern. Die Verankerung und Vernetzung lässt sich gut an, auch dank dem grundsätzlich enorm gestiegenen Interesse an Sicherheitspolitik. Dieser Umstand erleichtert es, uns in die laufenden Diskussionen einzubringen und wo erforderlich die Themenführung zu übernehmen. Wir stellen fest, dass viele Organisationen und Gremien die Interaktion mit dem SEPOS ganz gezielt suchen.
Wie findet diese Vernetzung, dieser Austausch im Alltag statt?
Sicherheitspolitik ist eine Verbundaufgabe par excellence. Der gegenseitige Austausch ist zentral, zwischen allen Akteuren und auf allen Ebenen. Stellvertretend dafür nenne ich zwei wichtige Gremien auf Stufe Bund: der Sicherheitsausschuss des Bundesrates (SiA), dessen Geschäftsstelle beim SEPOS angesiedelt ist, sowie die Kerngruppe Sicherheit (KGSi). Die Sitzungen des SiA werden vom SEPOS vorbereitet, protokolliert und nachbereitet; die KGSi ist ein vorberatendes Gremium für den SiA – da gibt es also eine sehr enge, institutionalisierte und themenbezogene Zusammenarbeit zwischen mehreren Departementen und sicherheitsrelevanten Bundesämtern.
Mit der Sicherheitspolitischen Strategie 2025 haben wir den Anspruch, die Strategie methodisch nachvollziehbarer darzustellen als bisher mit den Sicherheitspolitischen Berichten.
Sicherheitspolitiker und Sicherheitspolitikerinnen monieren seit geraumer Zeit, dass eine Strategie des Bundesrates fehle – jetzt sind jedoch die Arbeiten angelaufen, und die Sicherheitspolitische Strategie des Bundesrates soll wie erwähnt Ende 2025 verabschiedet werden. Wird damit ein Paradigmenwechsel in Richtung einer «Grand Strategy» einhergehen? Ist eine solche überhaupt möglich?
Ich möchte gerne grundsätzlich beginnen: Die Schweiz hat eine Strategie, aber sie manifestiert sich weniger offensichtlich und schon gar nicht in einem einzigen Wurf. Die Schweiz war noch nie das Land der grossen, allumfassenden politischen Strategiepapiere. Unsere politischen Grundlagen entstehen schrittweise, in eidgenössischer Manier, stets unter Einbezug sämtlicher relevanter Akteure, möglichst inklusiv und kompromissorientiert, auch um damit breit abgestützte strategische Stossrichtungen zu entwickeln. Nehmen Sie als Beispiel die Fähigkeitsentwicklung der Armee, deren konzeptioneller Rahmen in mehreren übergeordneten Dokumenten definiert und veröffentlicht worden ist: den drei Grundlagenberichten Luft, Boden und Cyber, dem Zusatzbericht zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021, dem «Zielbild und Strategie für die Armee der Zukunft» («schwarzes Buch»), dem Postulatsbericht «Verteidigungsfähigkeit und Kooperation» und der Armeebotschaft 2024. Die Strategie ist in mehreren Dokumenten, die man vernetzt verstehen muss, enthalten. Das wird auch künftig nicht grundsätzlich anders sein. Mit der Sicherheitspolitischen Strategie 2025 haben wir den Anspruch, die Strategie methodisch nachvollziehbarer darzustellen als bisher mit den Sicherheitspolitischen Berichten. Dabei wird nur schon mit der begrifflichen Akzentverschiebung deutlich, dass wir eine Strategie formulieren, und nicht einen Bericht vorlegen. Noch wichtiger als der Titel wird aber die inhaltliche Substanz sein.
Was heisst das konkret?
Es geht um eine Analyse der Bedrohungen und Gefahren, die Gegenüberstellung mit den Werten und Interessen der Schweiz, die Definition der sicherheitspolitischen Ziele und Prioritäten – und daraus soll abgeleitet werden, auf welchen Wegen und nach welchen Prinzipien wir diese Ziele erreichen wollen, welche Schwerpunkte wir dabei setzen und welche Instrumente wir dafür benötigen – und, ganz wichtig, wie diese sicherheitspolitischen Instrumente ineinandergreifen und zusammenwirken müssen. Wenn wir diese Strategieelemente zusammenbringen und dazu Klarheit schaffen können, wo wir besonders gefordert sind, wo übergeordneter Handlungsbedarf besteht und wie wir unsere Ziele letztlich erreichen können – dann werden wir dem Anspruch an eine Strategie gerecht. Mit dem Einbezug aller Partner soll diese Strategie breit abgestützt und verankert werden, was die Umsetzung überhaupt erst ermöglichen wird.
Werden also in der Sicherheitspolitischen Strategie 2025 auch die nationalen Interessen der Schweiz definiert?
Unsere übergeordneten nationalen Interessen sind in der Bundesverfassung formuliert, beispielsweise im Artikel 2, wo der Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft genannt wird. Darin sind auch Interessen mit Bezug zur Sicherheitspolitik formuliert, etwa die «Wahrung der Freiheit und der Rechte des Volkes» sowie die «Wahrung der Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes». Von diesen Bestimmungen wird die Sicherheitspolitische Strategie 2025 konkrete sicherheitspolitische Interessen und Ziele ableiten. Komplett neu ist dieses Vorgehen nicht, das war durchaus auch schon bei der Erarbeitung der bestehenden Sicherheitspolitischen Berichte des Bundesrates der Fall.
Die regelbasierte internationale Ordnung ist die Grundlage für unsere eigene Unabhängigkeit und Sicherheit, inklusive unserer territorialer Unversehrtheit.
Weltweit werden mehrere Kriege geführt, dazu kommen etliche blutige Konflikte unterhalb der Kriegsschwelle; etliche Demokratien geraten unter Druck, Machtpolitik und das Recht des Stärkeren wird zunehmend unverhohlen praktiziert, der Ukrainekrieg ist ein geostrategischer Wendepunkt. Was kann die Schweiz in die Waagschale legen, um zu einer regelbasierten internationalen Ordnung beizutragen? Welche Werkzeuge kann die Schweiz einsetzen?
Die regelbasierte internationale Ordnung ist die Grundlage für unsere eigene Unabhängigkeit und Sicherheit, inklusive unserer territorialer Unversehrtheit. Wir haben also ein ureigenes Interesse, diese regelbasierte internationale Ordnung, in deren Kern die UNO-Charta steht, zu pflegen und zu ihrem Erhalt beizutragen. Aktuell könnte man zum Schluss kommen, dass der neutrale Kleinstaat den vorherrschenden geopolitischen Rivalitäten machtlos ausgeliefert ist. Es trifft natürlich zu, dass die Schweiz alleine die Erosion der regelbasierten internationalen Ordnung nicht aufhalten kann. Es trifft jedoch auch zu, dass die Schweiz durchaus einen Beitrag zur Wahrung dieser Ordnung leisten kann. Es gilt, das grosse Ganze zu sehen: Je mehr Staaten mit ihren gemeinsamen Werten sich dafür stark machen, desto stärker wirkt der Beitrag jedes einzelnen Staates, desto mehr werden alle Staaten von Betroffenen zu Beteiligten. Und können etwas bewirken.
Und was kann die Schweiz beitragen respektive bewirken?
Hier gilt es, die Handlungsmöglichkeiten der Schweiz insgesamt zu betrachten. Die Schweiz ist territorial und demografisch ein Kleinstaat, der seine Interessen nicht mit Hard Power durchsetzt. Die Schweiz ist aber in vielen anderen Bereichen eine Mittelmacht, ein Staat mit sehr viel Soft Power und sogar Smart Power. Diese Eigenschaften und Kompetenzen können und müssen wir einbringen zugunsten des Erhalts einer internationalen Ordnung, in der Recht weiterhin vor Macht steht und Interessenkonflikte mittels gemeinsam vereinbarter Regeln auf friedlichem Weg ausgetragen werden.
Können Sie konkrete Beispiele nennen?
Wir sind punkto Diplomatie ein sehr glaubwürdiger und potenter Staat, wir sind stark im Bereich des humanitären Engagements, des Völkerrechts und der Menschenrechte; wir pflegen weit verzweigte Handelsbeziehungen, die wir auch zur Stärkung der internationalen Regeln einsetzen können; wir leisten wesentliche Beiträge an die Stabilität des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems, und wir können unsere Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit oder auch unseren gut vernetzten und rundum anerkannten Bildungs- und Forschungssektor sowie unsere Innovationsfähigkeit in den Dienst einer friedlichen Weltordnung stellen. Die Schweiz kann einiges in die Waagschale werfen. Und wir können deshalb eine Rolle dabei spielen, auch und gerade Staaten aus dem sogenannten globalen Süden zu motivieren, sich am Erhalt dieser Ordnung zu beteiligen.
Und in Bezug auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik?
Auch diesbezüglich leistet die Schweiz wenn auch kleine, so doch qualitativ hochstehende und relevante Beiträge, in der militärischen Friedensförderung im Rahmen von UNO-mandatierten Missionen und auch bei der Ausbildung sowie konzeptionellen Weiterentwicklung internationaler Friedensoperationen. Aber auch die Absicht des Bundesrates, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken, die sicherheitspolitische Kooperation mit unseren europäischen Partnern zu intensivieren und ein solidarisch sowie verlässlich handelnder Sicherheitsakteur auf dem europäischen Kontinent zu sein, trägt letztlich zum Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung bei.
Vereinfacht gesagt sehen wir drei Weltordnungen: der globale Westen, angeführt von den USA, mit Grossbritannien, Australien, Südkorea, aber auch der EU und der Schweiz; der globale Osten, die autokratischen Revisionisten, mit China, Russland und dem Iran; der globale Süden, die Reformisten, mit Indien, der Türkei, afrikanischen und südamerikanischen Staaten. Wie muss sich die Schweiz positionieren?
Wo wir mit Blick auf unsere Werte und Interessen stehen, liegt auf der Hand. Wir stehen auf der Seite der regelbasierten internationalen Ordnung, welche auch die Grundlage für unsere Sicherheit und unsere Prosperität ist. Deshalb sind wir auch bemüht, uns mit gleichgesinnten Staaten und internationalen Organisation dafür einzusetzen. Es gibt verschiedene theoretische Ansätze zur Aufteilung der Welt in Sphären, einer davon ist derjenige dieser drei Sphären, bestehend aus dem globalen Westen, dem globalen Osten und dem globalen Süden. Diese letztere Staatengruppe ist sehr heterogen, sie umfasst unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen sowie Staats- und Gesellschaftsmodelle. Gemeinsam ist diesen Staaten des globalen Südens jedoch die zurecht geäusserte Forderung, die internationale Ordnung und ihre Spielregeln mitgestalten zu können. Es ist wichtig, dass die Schweiz mithilft, bei den Staaten des globalen Südens sowohl das Verständnis als auch das Commitment für die bestehende regelbasierte internationale Ordnung zu fördern – im Wissen darum, dass diese zwar nicht perfekt, aber insgesamt eine auf Ausgleich und Inklusion ausgerichtete sowie auf Regeln und Völkerrecht basierende Ordnung ist, für die einzustehen es sich lohnt, im Interesse von uns allen.
Also reden mit allen, auch wenn sie die Werte der regelbasierten internationalen Ordnung nicht uneingeschränkt teilen mögen?
Ja, wir müssen mit allen reden, aber wir müssen vor allem auch zuhören können. Gerade die Staaten des globalen Südens haben eine andere Geschichte, haben andere Rahmenbedingungen. Eine rein eurozentristische Perspektive ist also verfehlt. Wir müssen bereit sein, auch andere Ideen und Lösungsansätze einzubeziehen.
Das Verständnis unserer Partner endet dort, wo die Schweiz andere Staaten daran hindert, die Ukraine in ihrem existenziellen Abwehrkampf zu unterstützen.
Trügt der Eindruck, oder hat die Schweiz seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in vielen westlichen Demokratien an Ansehen eingebüsst, Stichwort Rosinenpickerei? Wie nehmen Sie das wahr?
Unsere Haltung und unser Handeln werden von unseren internationalen Partnern aufmerksam verfolgt und beeinflussen deren Bereitschaft, mit der Schweiz zu kooperieren. Grundsätzlich haben die Partner in unserem strategischen Umfeld – Nachbarstaaten, NATO, Europäische Union – Verständnis dafür, dass die Schweiz an ihrer Neutralität festhält. Diese wird akzeptiert, solange es sich nicht um Gesinnungsneutralität handelt, bei der nicht zwischen Opfer und Aggression unterschieden würde. Die Schweiz hat die völkerrechtswidrige Aggression Russlands gegen die Ukraine klar verurteilt und leistet dem kriegsversehrten Land humanitäre Hilfe, gleichzeitig setzt sie das Neutralitätsrecht vollständig um, indem sie keine der Kriegsparteien militärisch unterstützt.
Und wo ist der Haken?
Das Verständnis unserer Partner endet dort, wo die Schweiz andere Staaten daran hindert, die Ukraine in ihrem existenziellen Abwehrkampf zu unterstützen. Stichwort ist die Nichtwiederausfuhr; dafür gibt es wenig Verständnis in unserem Umfeld. Meine ausländischen Gesprächspartner weise ich jeweils auf unsere gesetzlichen Grundlagen sowie auf die Eigenheiten unserer demokratischen und politischen Prozesse hin. Unsere Partner erwarten hierbei, dass die Schweiz ihre Gesetzeslage anpasst; entsprechende Diskussionen laufen im Parlament. Insgesamt geniesst die Schweiz weiterhin einen guten Ruf, auch weil wir auf diplomatischer Ebene klar Position bezogen und Plattformen geschaffen haben.
Die Schweiz ist seit dem 1. Januar 2023 und bis zum 31. Dezember 2024 Mitglied im UNO-Sicherheitsrat. Wie beeinflusst diese Mitgliedschaft Ihre Arbeit?
Federführend punkto UNO-Sicherheitsrat ist das Departement für auswärtige Angelegenheiten, das EDA, aber das VBS leistet substanzielle Beiträge, bei denen wiederum das SEPOS die Koordination innerhalb des VBS wahrnimmt. Seit unserem Einsitz im Sicherheitsrat haben wir viele neue Erkenntnisse über die internationale Sicherheit gewinnen können. Dieses Wissen lassen wir nun in unsere sicherheits- und aussenpolitischen Überlegungen einfliessen.
Der Bundesrat hat eine verstärkte Zusammenarbeit unserer Armee mit ausländischen Partnern zur Priorität erklärt. Was ist konkret möglich? Was geht nicht? Gibt es Grauzonen? Wo sehen Sie Spielraum?
Ein Erfahrungsaustausch im Bereich der militärischen Zusammenarbeit und gemeinsame Ausbildungen finden seit Mitte der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts statt, wurden kontinuierlich ausgebaut und sind gelebte Realität. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn wir von einer Stärkung dieser Zusammenarbeit reden. Selbstverständlich gibt es noch Spielraum, diese Zusammenarbeit auszubauen – und diesen Spielraum wollen wir nutzen, um unsere Armee weiterzuentwickeln. In Bezug auf gemeinsame Ausbildung und Erfahrungsaustausch mit Partnerarmeen liegt es beispielsweise in unserem Interesse, uns noch mehr auf die qualitative Verbesserung unserer Verteidigungsfähigkeit auszurichten. Eine Möglichkeit dafür ist, dass inskünftig nicht nur die Luftwaffe, Spezialkräfte und Cyber-Spezialistinnen und -Spezialisten, sondern auch Verbände des Heeres – wo der Milizanteil höher ist – mit ausländischen Partnern zusammen trainieren, wie dies bei der Übung «TRIAS 25» im kommenden Frühling auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig in Österreich der Fall sein wird. Und nicht zu vergessen: Auch die Informationssicherheit ist Voraussetzung für Kooperation. Nur wenn wir unseren Partnern garantieren können, dass sicherheitsrelevante Informationen bei uns in sicheren Händen sind, werden sie diese mit uns teilen.
Die roten Linien sind dort, wo wir Verpflichtungen eingehen würden, die Sachzwänge schaffen würden, die nicht mit unserer Neutralität im Einklang wären.
Gibt es rote Linien?
Ja, die gibt es. Die roten Linien sind dort, wo wir Verpflichtungen eingehen würden, die Sachzwänge schaffen würden, die nicht mit unserer Neutralität im Einklang wären. Sämtliche internationalen Engagements der Armee in Form von Einsätzen unterliegen einer separaten politischen Beurteilung und Entscheidungsfindung.
Eine mögliche Annäherung an die NATO wird von gewissen Kreisen stark kritisiert. Aber gibt es überhaupt Alternativen für die Schweiz und die Schweizer Armee im Bereich der Ausbildung?
Es gilt, zwischen der politischen und der militärischen Ebene zu unterscheiden. Zur politischen Ebene: Wir sind seit 1996 an der Partnerschaft für den Frieden der NATO beteiligt. Dieser institutionelle Rahmen hat sich nicht verändert, er bleibt gleich. Der Vorwurf, das VBS treibe die Annäherung an die NATO voran, geht an der Realität vorbei. Schon der Begriff der Annäherung ist irreführend. Wir nähern uns nicht an – wir sind schon seit bald drei Jahrzehnten in einer engen und bewährten partnerschaftlichen Beziehung. Es gibt in dieser Diskussion um die Beziehung der Schweiz zur NATO viele Missverständnisse. Fakt ist: Wir sind ein Partnerstaat der NATO und halten in dieser Beziehung unsere aussen- und sicherheitspolitischen Grundsätze ein, wozu auch die Neutralität gehört. Die internationale Zusammenarbeit ist kein Selbstzweck, sie dient der Wahrung unserer nationalen Sicherheitsinteressen, sie erhöht die Sicherheit der Schweiz und ihrer Bevölkerung.
Und was bedeutet das auf der militärischen Ebene?
Die verschlechterte Sicherheitslage zwingt uns, die Armee wieder stärker auf die Verteidigungsfähigkeit auszurichten, in sämtlichen Entwicklungsbereichen: Doktrin, Ausbildung, Material, Fähigkeiten. In fast all diesen Bereichen geht das nicht mehr ohne Zusammenarbeit mit Partnern. Dabei ist es essenziell, zu verstehen, wie sich die NATO-Staaten auf die Verteidigung vorbereiten. Dies ist Voraussetzung für die bedrohungsgerechte Weiterentwicklung unserer eigenen Fähigkeiten. Und sollte die Schweiz einmal direkt angegriffen werden, würde die Neutralität hinfällig, und es stünde uns frei, unsere Souveränität und territoriale Integrität zusammen mit Partnern zu verteidigen. Wir müssen also die Einsatzverfahren und Prozesse unserer europäischen Partner nicht nur kennen, sondern auch soweit beherrschen, dass im Notfall und dem politischen Willen folgend eine erfolgversprechende Zusammenarbeit möglich wäre. Nur so kann die Schweizer Armee dem Anspruch gerecht werden, unser Land im Fall einer militärischen Aggression nicht ausschliesslich eigenständig, sondern bei Bedarf und Möglichkeit auch zusammen mit unseren Partnern verteidigen zu können. Die entsprechende Befähigung der Armee verschafft der Politik entsprechenden strategischen Handlungsspielraum. Deshalb sind die militärische Ausbildungszusammenarbeit, die Teilnahme an internationalen Übungen sowie die Überprüfung unserer Fähigkeiten im multinationalen Rahmen zentral.
Im Sommer war General Robert Brieger in der Schweiz, der Vorsitzende des EU-Militärausschusses. Gegenstand seines offiziellen Besuches war die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Wie weit ist diese gediehen?
Ganz grundsätzlich ist die Zusammenarbeit der EU im sicherheitspolitischen Bereich mit Drittstaaten weniger institutionalisiert als jene der NATO mit ihren Partnerstaaten. Dennoch gibt es mittlerweile Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die uns interessieren. Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Verteidigungsagentur ist seit 2012 etabliert, die Armee nimmt beispielsweise teil an multinationalen Ausbildungen in den Bereichen Helikopterbesatzungen und Kampfmittelbeseitigung. Ausbaupotenzial besteht im Bereich der permanenten strukturierten Kooperation PESCO der EU, wo sich interessierte Drittstaaten bei bestimmten Projekten ebenfalls einbringen und von gemeinsamen Entwicklungen zur Stärkung ihrer eigenen Fähigkeiten profitieren können. Konkret können wir uns ein Engagement im Bereich Ausbildung für Cyber-Abwehr vorstellen. Die Schweiz leistet seit 2004 zudem einen Beitrag an die von der EU geführte friedensfördernde Mission EUFOR ALTHEA in Bosnien und Herzegowina.
Die politische Schweiz hat grosse Erfahrung mit Kompromissen; sind solche in der künftigen Sicherheitspolitik überhaupt möglich, in Anbetracht des russischen Angriffskriegs?
Die Dialog- und Kompromissfähigkeit der Schweiz ist Teil unseres Erfolgsrezepts, sie ist eine Stärke. Eine Demokratie ohne Kompromisse ist nur schwer denkbar, und das gilt auch für die Sicherheitspolitik. Wir müssen unserer politischen Kultur des Kompromisses und des konstruktiven Dialogs weiterhin Sorge tragen, auch wenn die Herausforderungen komplexer und die Diskussionen etwas hitziger geworden sind. Letztlich liegt die Stärke der schweizerischen Sicherheitspolitik im Verbund, im Einbezug aller relevanten zivilen und militärischen Partner. Das ist unsere bewährte eidgenössische Vorgehensweise, und diese führen wir fort.